 |
|
 |
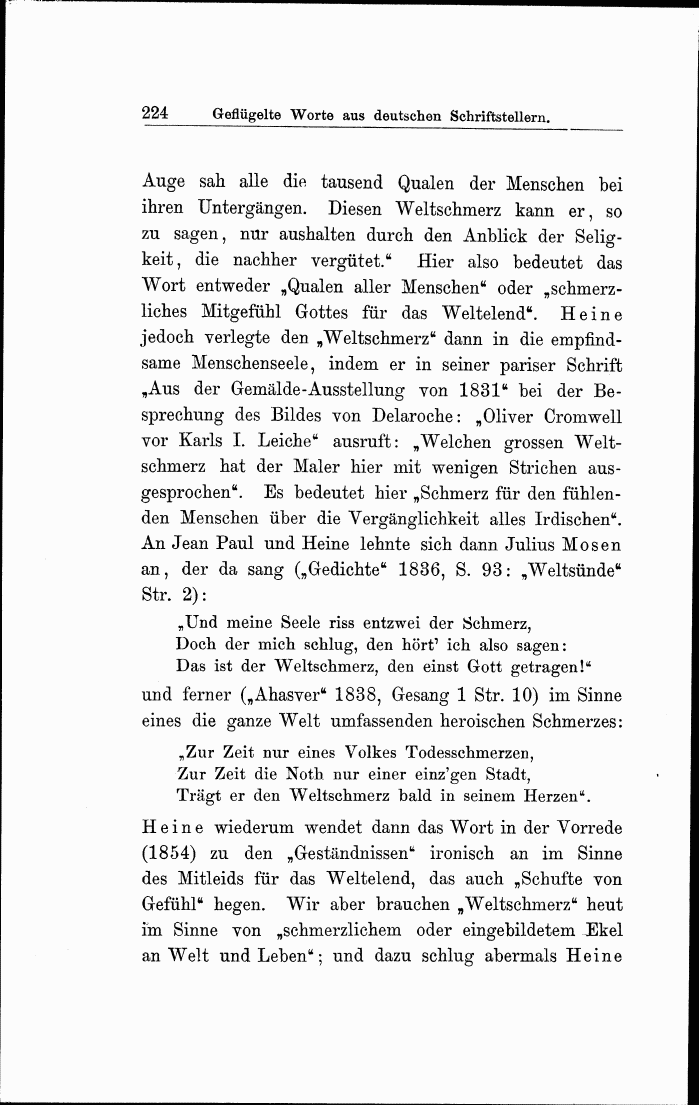
Seite: 224 – << vorige – nächste >> – Übersicht
Auge sah alle die tausend Qualen der Menschen bei
ihren Untergängen. Diesen Weltschmerz kann er, so
zu sagen, nur aushalten durch den Anblick der
Seligkeit, die nachher vergütet." Hier also bedeutet das
Wort entweder "Qualen aller Menschen" oder "schmerzliches
Mitgefühl Gottes für das Weltelend". Heine
jedoch verlegte den "Weltschmerz" dann in die empfindsame
Menschenseele, indem er in seiner pariser Schrift
"Aus der Gemälde-Ausstellung von 1831" bei der
Besprechung des Bildes von Delaroche: "Oliver Cromwell
vor Karls I. Leiche" ausruft: "Welchen grossen Weltschmerz
hat der Maler hier mit wenigen Strichen ausgesprochen".
Es bedeutet hier "Schmerz für den fühlenden
Menschen über die Vergänglichkeit alles Irdischen".
An Jean Paul und Heine lehnte sich dann Julius Mosen
an, der da sang ("Gedichte" 1836, S. 93: "Weltsünde"
Str. 2):
/*
"Und meine Seele riss entzwei der Schmerz,
Doch der mich schlug, den hört' ich also sagen:
Das ist der Weltschmerz, den einst Gott getragen!"
*/
und ferner ("Ahasver" 1838, Gesang 1 Str. 10) im Sinne
eines die ganze Welt umfassenden heroischen Schmerzes:
/*
"Zur Zeit nur eines Volkes Todesschmerzen,
Zur Zeit die Noth nur einer einz'gen Stadt,
Trägt er den Weltschmerz bald in seinem Herzen".
*/
Heine wiederum wendet dann das Wort in der Vorrede
(1854) zu den "Geständnissen" ironisch an im Sinne
des Mitleids für das Weltelend, das auch "Schufte von
Gefühl" hegen. Wir aber brauchen "Weltschmerz" heut
im Sinne von "schmerzlichem oder eingebildetem Ekel
an Welt und Leben"; und dazu schlug abermals Heine
Seite: 224 – << vorige – nächste >> – Übersicht