 |
|
 |
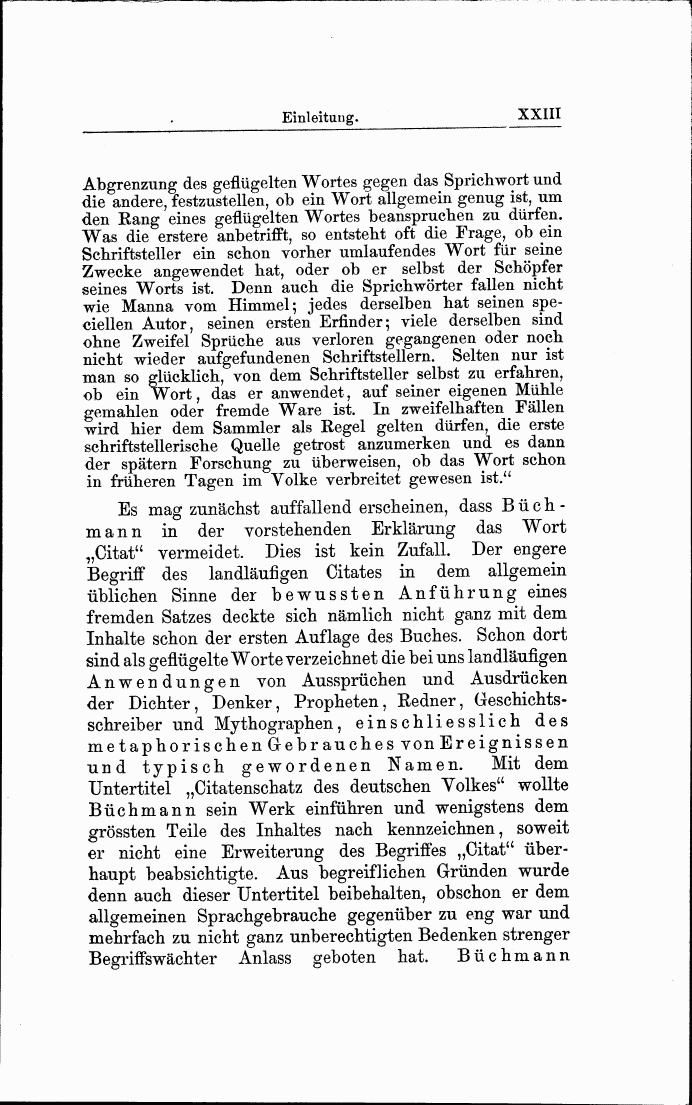
Seite: xxiii – << vorige – nächste >> – Übersicht
/# Abgrenzung des geflügelten Wortes gegen das Sprichwort und die andere, festzustellen, ob ein Wort allgemein genug ist, um den Rang eines geflügelten Wortes beanspruchen zu dürfen. Was die erstere anbetrifft, so entsteht oft die Frage, ob ein Schriftsteller ein schon vorher umlaufendes Wort für seine Zwecke angewendet hat, oder ob er selbst der Schöpfer seines Worts ist. Denn auch die Sprichwörter fallen nicht wie Manna vom Himmel; jedes derselben hat seinen speciellen Autor, seinen ersten Erfinder; viele derselben sind ohne Zweifel Sprüche aus verloren gegangenen oder noch nicht wieder aufgefundenen Schriftstellern. Selten nur ist man so glücklich, von dem Schriftsteller selbst zu erfahren, ob ein Wort, das er anwendet, auf seiner eigenen Mühle gemahlen oder fremde Ware ist. In zweifelhaften Fällen wird hier dem Sammler als Regel gelten dürfen, die erste schriftstellerische Quelle getrost anzumerken und es dann der spätern Forschung zu überweisen, ob das Wort schon in früheren Tagen im Volke verbreitet gewesen ist." #/ Es mag zunächst auffallend erscheinen, dass Büchmann in der vorstehenden Erklärung das Wort "Citat" vermeidet. Dies ist kein Zufall. Der engere Begriff des landläufigen Citates in dem allgemein üblichen Sinne der bewussten Anführung eines fremden Satzes deckte sich nämlich nicht ganz mit dem Inhalte schon der ersten Auflage des Buches. Schon dort sind als geflügelte Worte verzeichnet die bei uns landläufigen Anwendungen von Aussprüchen und Ausdrücken der Dichter, Denker, Propheten, Redner, Geschichtsschreiber und Mythographen, einschliesslich des metaphorischen Gebrauches von Ereignissen und typisch gewordenen Namen. Mit dem Untertitel "Citatenschatz des deutschen Volkes" wollte Büchmann sein Werk einführen und wenigstens dem grössten Teile des Inhaltes nach kennzeichnen, soweit er nicht eine Erweiterung des Begriffes "Citat" überhaupt beabsichtigte. Aus begreiflichen Gründen wurde denn auch dieser Untertitel beibehalten, obschon er dem allgemeinen Sprachgebrauche gegenüber zu eng war und mehrfach zu nicht ganz unberechtigten Bedenken strenger Begriffswächter Anlass geboten hat. Büchmann
Seite: xxiii – << vorige – nächste >> – Übersicht