 |
|
 |
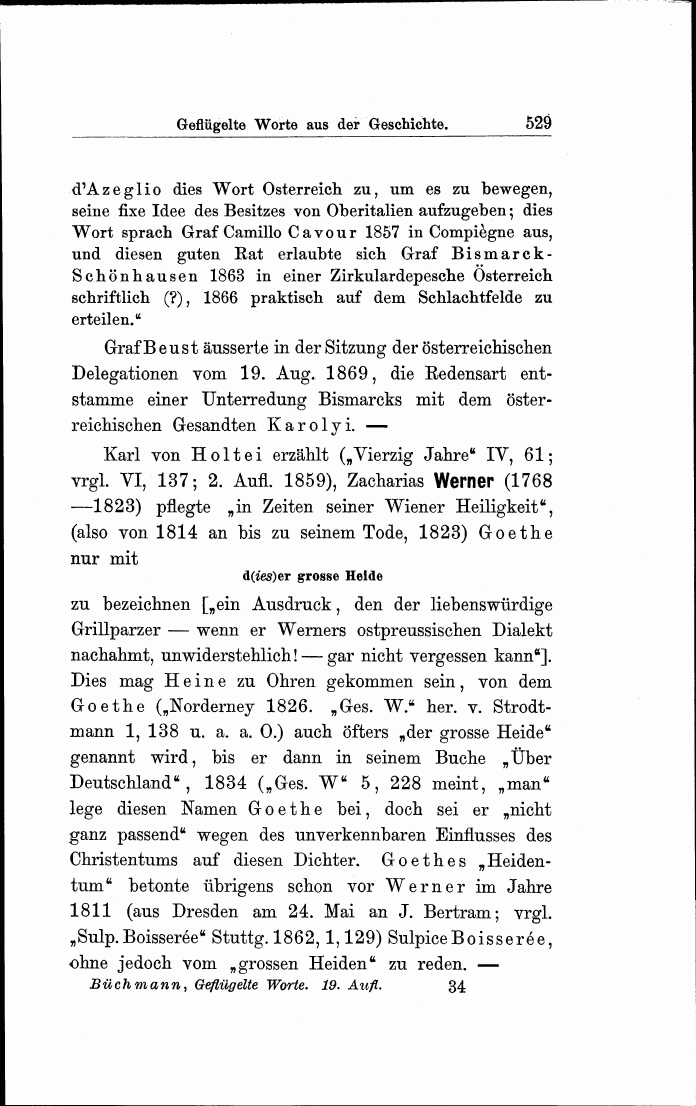
Seite: 529 – << vorige – nächste >> – Übersicht
d'<sp>Azeglio</sp> dies Wort Österreich[**changed O to Ö] zu, um es zu bewegen,
seine fixe Idee des Besitzes von Oberitalien aufzugeben; dies
Wort sprach Graf Camillo <sp>Cavour</sp> 1857 in Compiègne aus,
und diesen guten Rat erlaubte sich Graf <sp>Bismarck-Schönhausen</sp>
1863 in einer Zirkulardepesche Österreich
schriftlich (?), 1866 praktisch auf dem Schlachtfelde zu
erteilen."
Graf <sp>Benst</sp> äusserte in der Sitzung der österreichischen
Delegationen vom 19. Aug. 1869, die Redensart entstamme
einer Unterredung Bismarcks mit dem österreichischen
Gesandten <sp>Karolyi</sp>.--
Karl von <sp>Holtei</sp> erzählt ("Vierzig Jahre" IV, 61;
vrgl. VI, 137; 2. Aufl. 1859), Zacharias Werner (1768-1823)
pflegte "in Zeiten seiner Wiener Heiligkeit",
(also von 1814 an bis zu seinem Tode, 1823) <sp>Goethe</sp>
nur mit
/*
d(ies)er grosse Heide
*/
zu bezeichnen ["ein Ausdruck, den der liebenswürdige
Grillparzer--wenn er Werners ostpreussischen Dialekt
nachahmt, unwiderstehlich!--gar nicht vergessen kann"].
Dies mag <sp>Heine</sp> zu Ohren gekommen sein, von dem
<sp>Goethe</sp> ("Norderney 1826. "Ges. W." her. v. Strodtmann
1, 138 u. a. a. O.) auch öfters "der grosse Heide"
genannt wird, bis er dann in seinem Buche "Über
Deutschland", 1834 ("Ges. W" 5, 228 meint, "man"
lege diesen Namen <sp>Goethe</sp> bei, doch sei er "nicht
ganz passend" wegen des unverkennbaren Einflusses des
Christentums auf diesen Dichter. <sp>Goethes</sp> "Heidentum"
betonte übrigens schon vor Werner im Jahre
1811 (aus Dresden am 24. Mai an J. Bertram; vrgl.
"Sulp. Boisserée" Stuttg. 1862, 1, 129) Sulpice <sp>Boisserée</sp>,
ohne jedoch vom "grossen Heiden" zu reden.--
Seite: 529 – << vorige – nächste >> – Übersicht