 |
|
 |
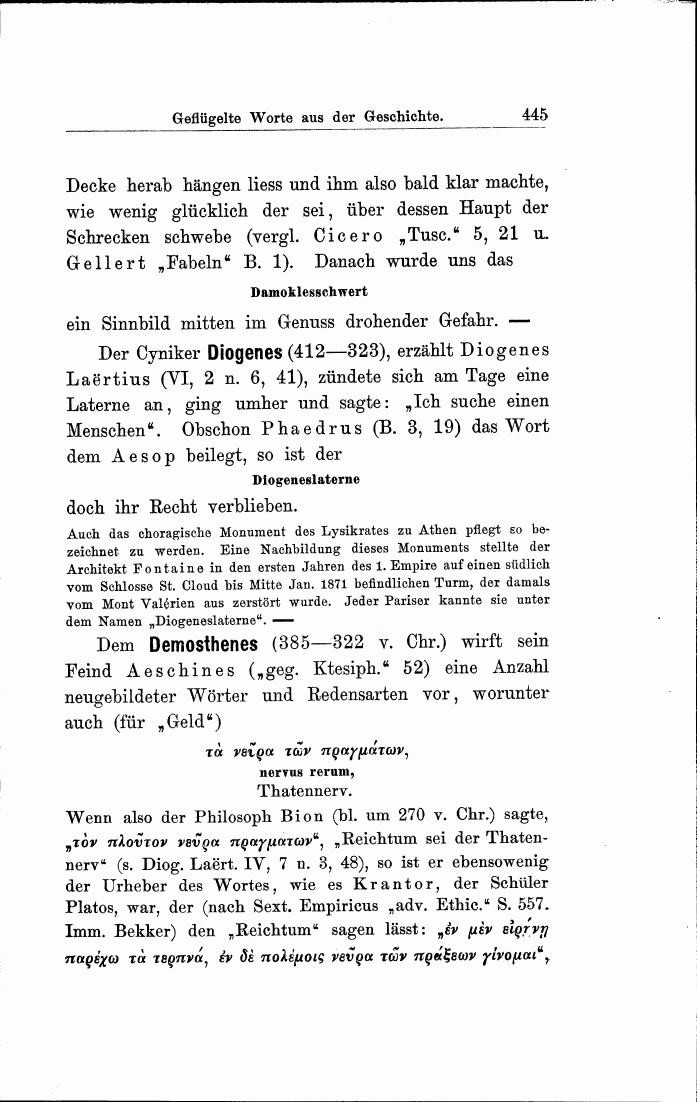
Seite: 445 – << vorige – nächste >> – Übersicht
Decke herab hängen liess und ihm also bald klar machte,
wie wenig glücklich der sei, über dessen Haupt der
Schrecken schwebe (vergl. <sp>Cicero</sp> "Tusc." 5, 21 u.
<sp>Gellert</sp> "Fabeln" B. 1). Danach wurde uns das
/*
Damoklesschwert
*/
ein Sinnbild mitten im Genuss drohender Gefahr.--
Der Cyniker Diogenes (412-323), erzählt <sp>Diogenes
Laërtius</sp> (VI, 2 n. 6, 41), zündete sich am Tage eine
Laterne an, ging umher und sagte: "Ich suche einen
Menschen". Obschon <sp>Phaedrus</sp> (B. 3, 19) das Wort
dem <sp>Aesop</sp> beilegt, so ist der
/*
Diogeneslaterne
*/
doch ihr Eecht verblieben.
Auch das choragische Monument des Lysikrates zu Athen pflegt so bezeichnet
zu werden. Eine Nachbildung dieses Monuments stellte der
Architekt <sp>Fontaine</sp> in den ersten Jahren des 1. Empire auf einen südlich
vom Schlosse St. Cloud bis Mitte Jan. 1871 befindlichen Turm, der damals
vom Mont Valérien aus zerstört wurde. Jeder Pariser kannte sie unter
dem Namen "Diogeneslaterne".--
Dem Demosthenes (385-322 v. Chr.) wirft sein
Feind <sp>Aeschines</sp> ("geg. Ktesiph." 52) eine Anzahl
neugebildeter Wörter und Redensarten vor, worunter
auch (für "Geld")
/*
[*greek: tha nehipha tahin êphagmhatôn],
nervus rerum,
Thatennerv.
*/
Wenn also der Philosoph Bion (bl. um 270 v. Chr.) sagte,
"[*greek: thon plouton nenra pragmatôn]", "Reichtum sei der Thatennerv"
(s. Diog. Laërt. IV, 7 u. 3, 48), so ist er ebensowenig
der Urheber des Wortes, wie es <sp>Krantor</sp>, der Schüler
Platos, war, der (nach Sext. Empiricus "adv. Ethic." S. 557.
Imm. Bekker) den "Reichtum" sagen lässt: "[*greek: zn mhdn shirhngê
parhechô tha tsrpnha, hen gi polhemois neupha tôn prhaxeôn ginomai][**not sure]",
Seite: 445 – << vorige – nächste >> – Übersicht