 |
|
 |
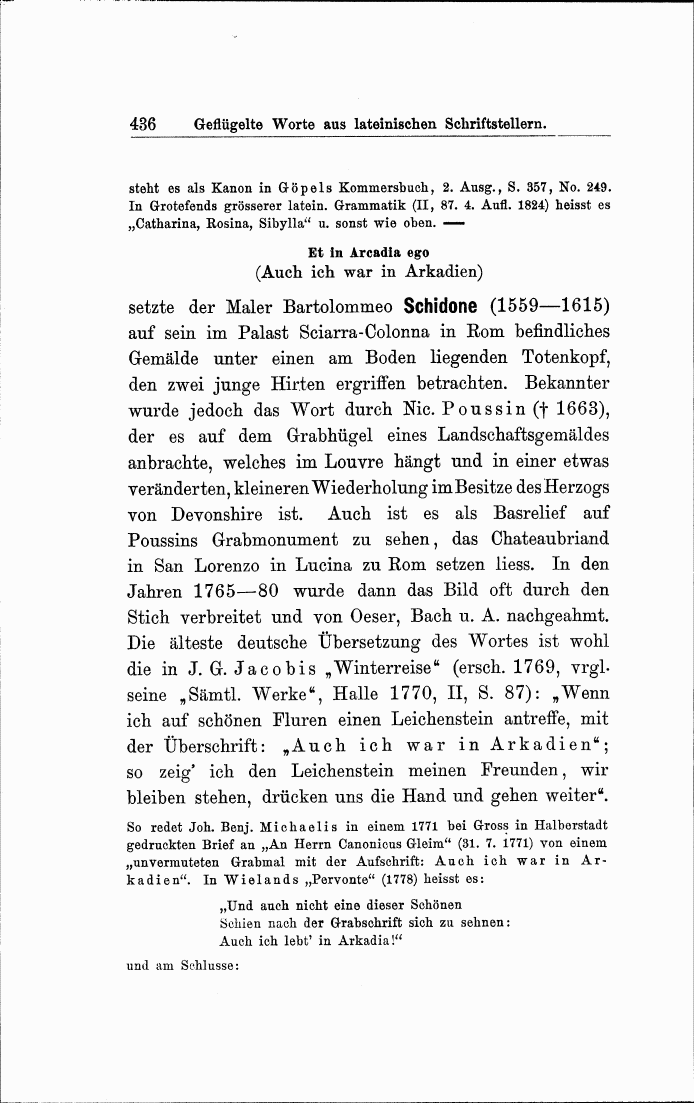
Seite: 436 – << vorige – nächste >> – Übersicht
steht es als Kanon in <sp>Göpels</sp> Kommersbuch, 2. Ausg., S. 357, No. 249. In Grotefends grösserer latein. Grammatik (II, 87. 4. Aufl. 1824) heisst es "Catharina, Rosina, Sibylla" u. sonst wie oben.-- /* Et in Arcadia ego (Auch ich war in Arkadien) */ setzte der Maler Bartolommeo Schidone (1559-1615) auf sein im Palast Sciarra-Colonna in Rom befindliches Gemälde unter einen am Boden liegenden Totenkopf, den zwei junge Hirten ergriffen betrachten. Bekannter wurde jedoch das Wort durch Nie. <sp>Poussin</sp> ([*dagger] 1663), der es auf dem Grabhügel eines Landschaftsgemäldes anbrachte, welches im Louvre hängt und in einer etwas veränderten, kleineren Wiederholung im Besitze des Herzogs von Devonshire ist. Auch ist es als Basrelief auf Poussins Grabmonument zu sehen, das Chateaubriand in San Lorenzo in Lucina zu Rom setzen liess. In den Jahren 1765-80 wurde dann das Bild oft durch den Stich verbreitet und von Oeser, Bach u. A. nachgeahmt. Die älteste deutsche Übersetzung des Wortes ist wohl die in J. G. <sp>Jacobis</sp> "Winterreise" (ersch. 1769, vrgl. seine "Sämtl. Werke", Halle 1770, II, S. 87): "Wenn ich auf schönen Fluren einen Leichenstein antreffe, mit der Überschrift: "<sp>Auch ich war in Arkadien</sp>"; so zeig* ich den Leichenstein meinen Freunden, wir bleiben stehen, drücken uns die Hand und gehen weiter". So redet Joh. Benj. Michaelis in einem 1771 bei Gross in Halberstadt gedruckten Brief an "An Herrn Canonicus Gleim" (31. 7. 1771) von einem "unvermuteten Grabmal mit der Aufschrift: <sp>Auch ich war in Arkadien</sp>". In <sp>Wielands</sp> "Pervonte" (1778) heisst es: /* "Und auch nicht eine dieser Schönen Schien nach der Grabschrift sich zu sehnen: Auch ich lebt' in Arkadia!" */ und am Schlüsse:
Seite: 436 – << vorige – nächste >> – Übersicht