 |
|
 |
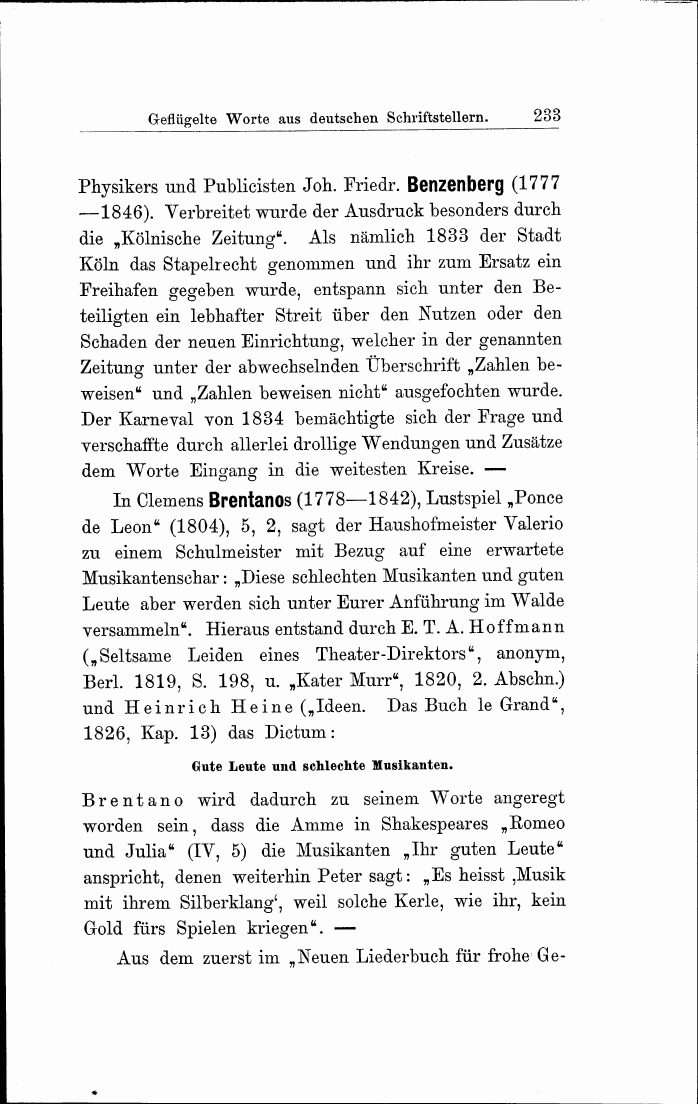
Seite: 233 – << vorige – nächste >> – Übersicht
Physikers und Publicisten Joh. Friedr. Benzenberg (1777-1846).
Verbreitet wurde der Ausdruck besonders durch
die "Kölnische Zeitung". Als nämlich 1833 der Stadt
Köln das Stapelrecht genommen und ihr zum Ersatz ein
Freihafen gegeben wurde, entspann sich unter den Beteiligten
ein lebhafter Streit über den Nutzen oder den
Schaden der neuen Einrichtung, welcher in der genannten
Zeitung unter der abwechselnden Überschrift "Zahlen beweisen"
und "Zahlen beweisen nicht" ausgefochten wurde.
Der Karneval von 1834 bemächtigte sich der Frage und
verschaffte durch allerlei drollige Wendungen und Zusätze
dem Worte Eingang in die weitesten Kreise.--
In Clemens Brentanos (1778-1842), Lustspiel "Ponce
de Leon" (1804), 5, 2, sagt der Haushofmeister Valerio
zu einem Schulmeister mit Bezug auf eine erwartete
Musikantenschar: "Diese schlechten Musikanten und guten
Leute aber werden sich unter Eurer Anführung im Walde
versammeln". Hieraus entstand durch E.T.A. Hoffmann
("Seltsame Leiden eines Theater-Direktors", anonym,
Berl. 1819, S. 198, u. "Kater Murr", 1820, 2. Abschn.)
und Heinrich Heine ("Ideen. Das Buch le Grand",
1826, Kap. 13) das Dictum:
Gute Leute und schlechte Musikanten.
Brentano wird dadurch zu seinem Worte angeregt
worden sein, dass die Amme in Shakespeares "Romeo
und Julia" (IV, 5) die Musikanten "Ihr guten Leute"
anspricht, denen weiterhin Peter sagt: "Es heisst 'Musik
mit ihrem Silberklang', weil solche Kerle, wie ihr, kein
Gold fürs Spielen kriegen".--
Aus dem zuerst im "Neuen Liederbuch für frohe Ge-*
Seite: 233 – << vorige – nächste >> – Übersicht