 |
|
 |
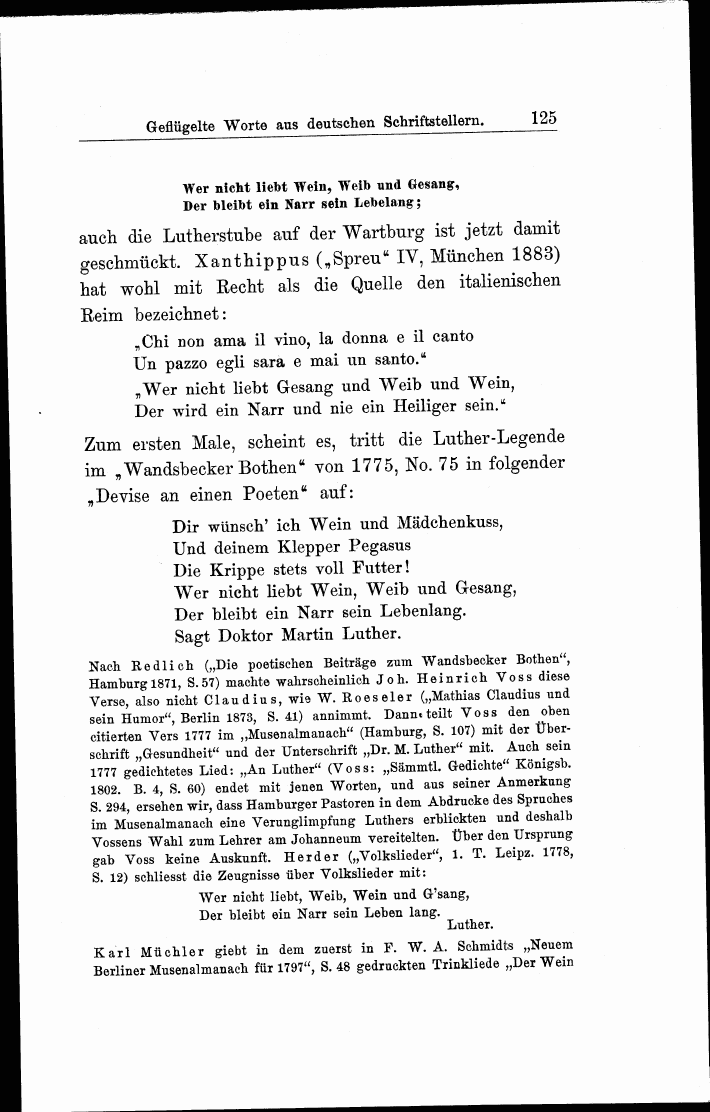
Seite: 125 – << vorige – nächste >> – Übersicht
Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
Der bleibt ein Narr sein Lebelang;
auch die Lutherstube auf der Wartburg ist jetzt damit
geschmückt. Xanthippus ("Spreu" IV, München 1883)
hat wohl mit Recht als die Quelle den italienischen
Reim bezeichnet:
/*
"Chi non ama il vino, la donna e il canto
Un pazzo egli sara e mai un santo."
"Wer nicht liebt Gesang und Weib und Wein,
Der wird ein Narr und nie ein Heiliger sein."
*/
Zum ersten Male, scheint es, tritt die Luther-Legende
im "Wandsbecker Bothen" von 1775, No. 75 in folgender
"Devise an einen Poeten" auf:
/*
Dir wünsch' ich Wein und Mädchenkuss,
Und deinem Klepper Pegasus
Die Krippe stets voll Futter!
Wer nicht liebt Wein, Weib und Gesang,
Der bleibt ein Narr sein Lebenlang.
Sagt Doktor Martin Luther.
*/
Nach Redlich ("Die poetischen Beiträge zum Wandsbecker Bothen",
Hamburg 1871, S. 57) machte wahrscheinlich Joh. Heinrich Voss diese
Verse, also nicht Claudius, wie W. Roeseler ("Mathias Claudius und
sein Humor", Berlin 1873, S. 41) annimmt. Dann teilt Voss den oben
citierten Vers 1777 im "Musenalmanach" (Hamburg, S. 107) mit der
Überschrift "Gesundheit" und der Unterschrift "Dr. M. Luther" mit. Auch sein
1777 gedichtetes Lied: "An Luther" (Voss: "Sämmtl. Gedichte" Königsb.
1802. B. 4, S. 60) endet mit jenen Worten, und aus seiner Anmerkung
S. 294, ersehen wir, dass Hamburger Pastoren in dem Abdrucke des Spruches
im Musenalmanach eine Verunglimpfung Luthers erblickten und deshalb
Vossens Wahl zum Lehrer am Johanneum vereitelten. Über den Ursprung
gab Voss keine Auskunft. Herder ("Volkslieder", 1. T. Leipz. 1778,
S. 12) schliesst die Zeugnisse über Volkslieder mit:
/*
Wer nicht liebt, Weib, Wein und G'sang,
Der bleibt ein Narr sein Leben lang.
Luther.
*/
Karl Müchler giebt in dem zuerst in F. W. A. Schmidts "Neuem
Berliner Musenalmanach für 1797", S. 48 gedruckten Trinkliede "Der Wein
Seite: 125 – << vorige – nächste >> – Übersicht