 |
|
 |
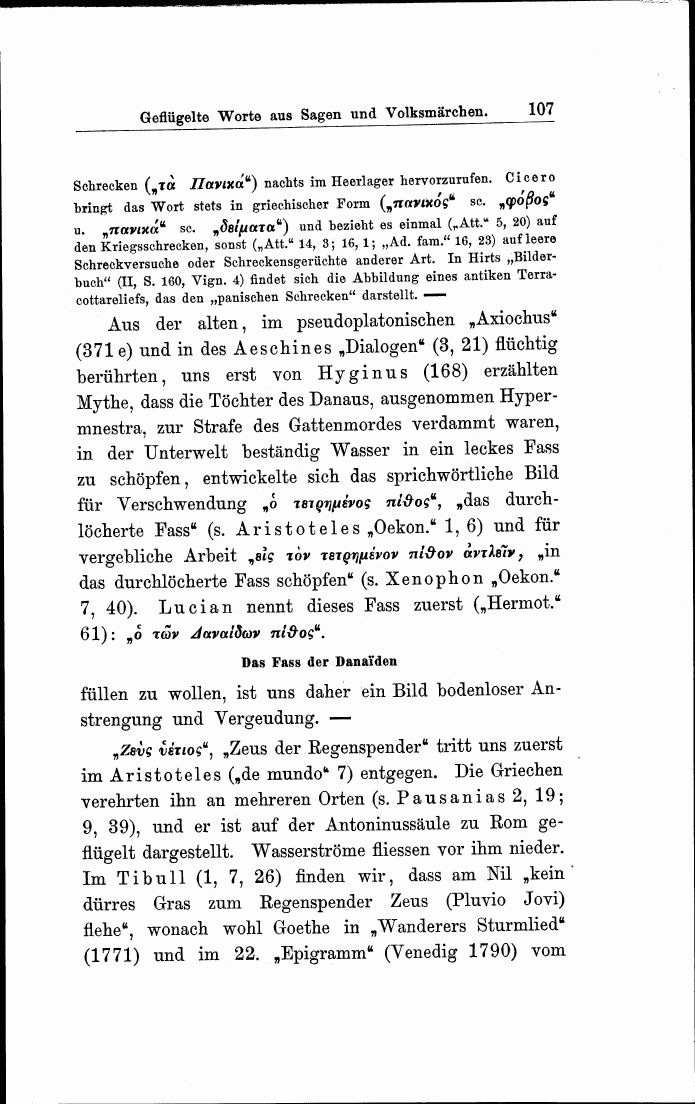
Seite: 107 – << vorige – nächste >> – Übersicht
Schrecken ("[Greek: ta Panika]" nachts im Heerlager hervorzurufen. Cicero
bringt das Wort stets in griechischer Form ("[Greek: panikos]" sc. "[Greek: pobos]"
u. "[Greek: pania]" sc. "[Greek: deimata]") und bezieht es einmal ("Att." 5, 20) auf
den Kriegsschrecken, sonst ("Att." 14, 3; 16, 1; "Ad. fam." 16, 23) auf leere
Schreckversuche oder Schreckensgerüchte anderer Art. In Hirts "Bilderbuch"
(II, S. 160, Vign. 4) findet sich die Abbildung eines antiken Terracottareliefs,
das den "panischen Schrecken" darstellt.--
Aus der alten, im pseudoplatonischen "Axiochus"
(371 e) und in des Aeschines "Dialogen" (3, 21) flüchtig
berührten, uns erst von Hyginus (168) erzählten
Mythe, dass die Töchter des Danaus, ausgenommen Hypermnestra,
zur Strafe des Gattenmordes verdammt waren,
in der Unterwelt beständig Wasser in ein leckes Fass
zu schöpfen, entwickelte sich das sprichwörtliche Bild
für Verschwendung "[Greek: ho tetrêmenos pithos]", "das durchlöcherte
Fass" (s. Aristoteles "Oekon." 1, 6) und für
vergebliche Arbeit "[Greek: eis ton tetrêmenon pithon antlein]", "in
das durchlöcherte Fass schöpfen" (s. Xenophon "Oekon."
7, 40). Lucian nennt dieses Fass zuerst ("Hermot."
61): "[Greek: ho tôn Danaidôn pithos].
Das Fass der Danaiden
füllen zu wollen, ist uns daher ein Bild bodenloser Anstrengung
und Vergeudung.--
[Greek: Zeus uetios], "Zeus der Regenspender" tritt uns zuerst
im Aristoteles ("de mundo" 7) entgegen. Die Griechen
verehrten ihn an mehreren Orten (s. Pausanias 2, 19;
9, 39), und er ist auf der Antoninussäule zu Rom geflügelt
dargestellt. Wasserströme fliessen vor ihm nieder.
Im Tibull (1, 7, 26) finden wir, dass am Nil "kein
dürres Gras zum Regenspender Zeus (Pluvio Jovi)
flehe", wonach wohl Goethe in "Wanderers Sturmlied"
(1771) und im 22. "Epigramm" (Venedig 1790) vom
Seite: 107 – << vorige – nächste >> – Übersicht